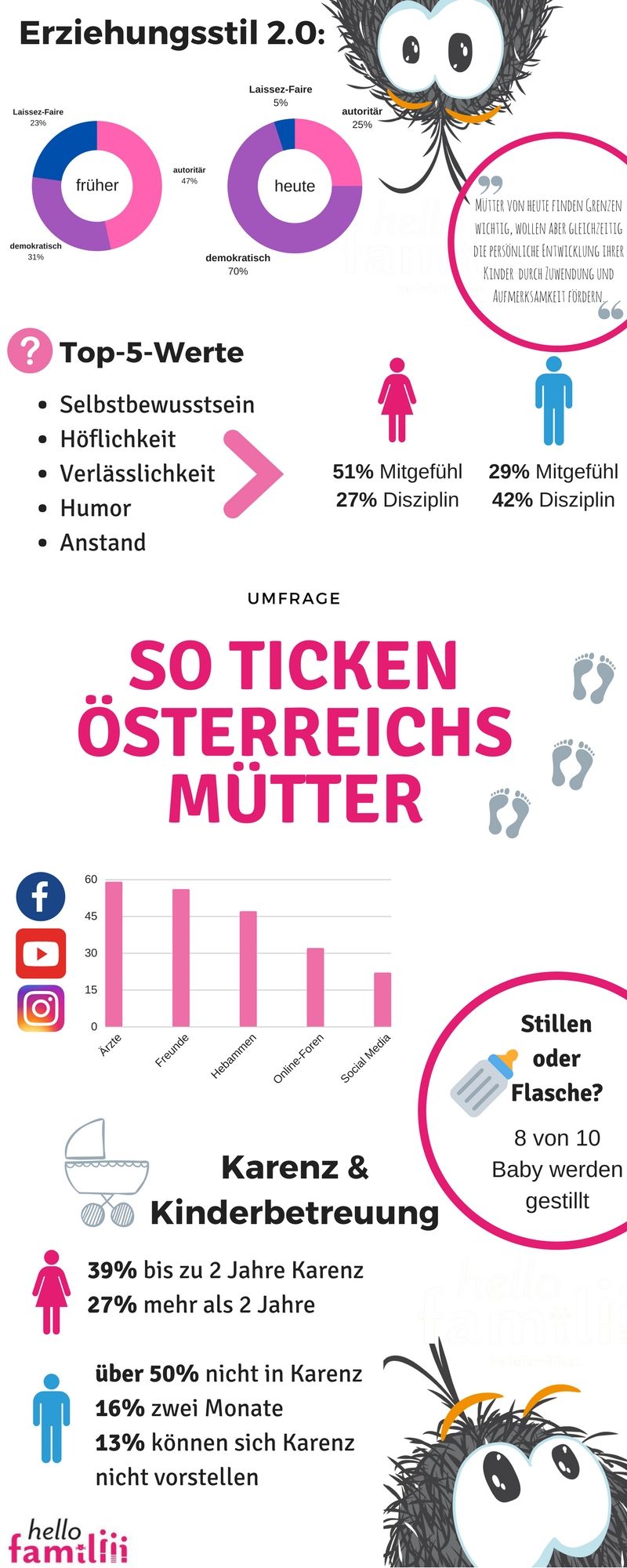Wann sollte man beginnen, sein Kind zur Selbstständigkeit zu erziehen?
Die Erziehung zur Selbstständigkeit ist ein Prozess, der mit der Geburt des Kindes beginnt und bis zur Entlassung aus der Erziehung andauert. Damit ein Kind überhaupt selbstständig werden kann, braucht es ein gewisses Urvertrauen. Kinder müssen sich sicher sein, dass sie bedingungslos geliebt werden, unabhängig von Erfolg oder Misserfolg. So können sie mutig die ersten Schritte in Richtung Selbstständigkeit gehen. Selbstständigkeit hat sehr viel mit Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl zu tun. Einem selbstbewussten Kind fällt es deutlich leichter, eigenständig zu handeln und Verantwortung zu übernehmen. Wichtig ist, dass Eltern erkennen, wie sie ihr Kind fördern können, ohne es zu überfordern.
Wie kann man ein Kind unterstützen, selbständig zu werden?
Kinder brauchen Freiräume, in denen sie Fähigkeiten testen und eigene Erfahrungen sammeln können, zum Beispiel in Spielgruppen, Sportvereinen, bei Ausflügen in die Natur und so weiter. Die Einbindung der Kinder bei der Hausarbeit und die damit verbundene Übertragung von Verantwortung fördern ebenfalls die Selbstständigkeit. Lassen Sie Ihrem Kind auch die Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen! Wen möchte das Kind zur Geburtstagsfeier einladen? Welche Torte wünscht sich das Kind? Wenn wir unsere Kinder öfter mal entscheiden lassen – besonders bei Dingen, die sie selbst betreffen –, lernen sie das Schritt für Schritt. Auch das soziale Miteinander erfordert Selbstständigkeit. Egal ob am Spielplatz, bei der Tagesmutter oder im Kindergarten, hier lernen sie, Kompromisse einzugehen, sich zu behaupten oder aber auch einmal zurückzustecken. Bei aller Selbstständigkeit ist es aber wichtig, dem Kind zu vermitteln, dass es sich an Regeln halten muss. Durch einen bestimmten Rahmen, den wir vorgeben, lernen die Kinder Verlässlichkeit und Verantwortungsgefühl.
Eltern müssen auch loslassen können?
Loslassen beginnt im Kopf der Eltern. Eltern sollten sich immer wieder bewusst machen, dass ihre Kinder eines Tages ihr eigenes Leben führen, selbstständig Entscheidungen treffen und vielleicht Verantwortung für ihre eigenen Kinder übernehmen werden. Oft fällt es Eltern leichter, loszulassen, wenn sie sich an ihre eigenen Abnabelungsversuche erinnern. Sicher können sich viele noch daran erinnern, wie schwer es war, die eigenen Eltern von etwas zu überzeugen. Und wie befriedigend und erleichternd, wenn das gelungen war. Das Hineinversetzen in die Wünsche der Kinder hilft dabei, sie langsam loslassen zu können.
Gibt es eine Richtlinie, ab welchem Alter ein Kind was können soll?
Natürlich gibt es Richtlinien. Die Frage, die wir Eltern uns stellen müssen, ist, ob diese Richtlinien unser Leben und das Leben unserer Kinder bestimmen sollen oder nicht. Mein Kind kann mit 15 Monaten noch nicht allein gehen, das Kind meiner Freundin ist schon mit zehn Monaten gelaufen. Das Kind einer Freundin kann mit fünf Jahren schon bis 30 zählen und mein Kind nicht einmal bis zehn. Was ist normal? Wichtig ist, sich auf das eigene Kind zu konzentrieren, bei
Problemen die nötige Hilfestellung zu gewähren, immer wieder ausprobieren zu lassen, das Kind immer wieder zu motivieren und vor allem dem eigenen Kind zu vertrauen.
Was ist, wenn das Kind viel mehr will, als es schon kann?
Aufgabe der Eltern ist es hier, den Prozess zur Zielerreichung in kleine Schritte zu zerlegen und Hilfestellung zu leisten. Zum Beispiel: Schuhe selber zubinden. Wenn man ein Kind hat, das dann gleich sauer wird, weil es das nicht schafft, dann versucht man, es in solche Schritte zu zerteilen, wo man weiß, das Kind schafft das. Zum Beispiel beim Schuhband die zwei Ohren zu legen und dann stopp und am nächsten Tag weiter. Das Kind hat zwischendurch Erfolgserlebnisse und das Selbstbewusstsein wird gestärkt, dadurch kann das Endziel motivierter erreicht werden. Hat das Kind ein Ziel erreicht, ist richtiges Loben sehr wichtig, denn das stärkt das Selbstbewusstsein.
Sollte man sein Kind mit anderen Kindern vergleichen?
Eltern sollten sich nicht in den Sog des Vergleichens begeben und einem fremden Zielbild hinterherhetzen. Es wird immer ein Kind geben, das in bestimmten Bereichen mehr kann. Weil es selbstständiger ist, weil es geschickter ist, weil es Geschwisterkinder hat, weil es belastbarer ist, weil es leisten muss, um geliebt zu werden, und so weiter. Es ist wichtig, dass die Eltern kühlen Kopf bewahren und das Kind behutsam und sacht im eigenen Tempo gehen lassen. Man kann es ein bisschen hineinschubsen und sagen: „Probiere das noch einmal. Ich stehe hier, du kannst noch einmal versuchen hinaufzuklettern. Du schaffst das schon.“ Positiv motivieren, aber nicht überfordern.