Das Geschäft mit dem Geschlecht
Piraten- und Ritterwelten für Buben. Schminke und Kochutensilien für Mädchen. Die Spielwelten unserer Kinder sind meist strikt nach Geschlechtern getrennt und transportieren stereotype Rollenbilder. Spielen Buben wirklich nicht mit Puppen und wollen Mädchen partout nichts bauen?

Nirgends ist die Welt so streng nach Geschlechtern und Rollenklischees getrennt wie bei den Spielsachen der Kids: Pinke Prinzessinnen und Einhörner auf der einen, blaue Superhelden und Dinos auf der anderen Seite. Fußballthemen, Experimentier- und Baukästen richten sich überwiegend an Buben. Über der ganzen rosa Welt mit Lebensbereichen wie Küche, Haushalt und Körperpflege schwebt meist das Etikett „for girls only“.
Alles angeboren oder was?
Nicht umsonst sind Spielzeugunternehmen wegen der klischeehaften Rollenbilder regelmäßig mit Sexismusvorwürfen konfrontiert. Die Firmen reagieren darauf oft mit dem Argument: Werbung sei ein Spiegel der Gesellschaft und die vermarkteten Produkte würden schlichtweg den Wünschen der Kinderkundschaft entsprechen. Weil: Buben wollen nun mal lieber mit Bagger und Mädchen lieber mit Puppen spielen. Ob typische Vorlieben von Buben und Mädchen sozusagen in der Natur der Sache liegen, damit beschäftigt sich die Forschung schon lange. Auf Spielplätzen und in den Kindergärten lässt sich tatsächlich beobachten, dass Jungs generell häufiger Spielformate mit turbulenten Aktionsszenen sowie mutigen Helden mögen, während sich die Begeisterung für Bagger und Bauen bei Mädchen im Schnitt eher in Grenzen hält. Der renommierte Neurobiologe Gerald Hüther schreibt in seinem Buch „Männer – das schwache Geschlecht und sein Gehirn“, über die Rolle des biologischen Geschlechts der Kinder für ihre Entwicklung und ihr Verhalten: „Zwar sind die genetischen Anlagen für die Ausbildung des Gehirns bei beiden Geschlechtern gleich, weil ja bis auf das Y-Chromosom Männer und Frauen dieselben Chromosomen besitzen. Doch auf dem Y steht drauf, dass dem Embryo Hoden wachsen. Und die wiederum produzieren das Hormon Testosteron, weshalb die Hirnentwicklung bei männlichen und weiblichen Embryos unter anderen Rahmenbedingungen stattfindet“. Vergleichen könne man das kindliche Gehirn mit einem Orchester: „Eigentlich ist die Besetzung bei Männern und Frauen gleich. Aber wegen der vorgeburtlichen Testosteroneinwirkung rücken im Orchester der kleinen Jungen die Pauken und Trompeten stärker nach vorne, während die harmonischen Instrumente in den Hintergrund treten“.
Anders gesagt: Jungs machen sich von Anfang an mit etwas mehr Antrieb auf den Weg, sich stärker im Raum orientieren und nach etwas suchen, das ihnen Bedeutsamkeit verschafft. Daraus erklärt der Hirnforscher die durchschnittlich hohe Affinität von Buben zu allem, was gewaltig, mächtig und stark aussieht. Dass das biologische Geschlecht der Kinder für ihre Entwicklung und ihr Verhalten eine Rolle spielt, weiß auch Kinderarzt und Hormonspezialist Oliver Blankenstein von der Berliner Charité : „Weibliche Frühgeborene haben bessere Überlebenschancen, vierjährige Mädchen sind – im Durchschnitt – feinmotorisch geschickter und in der sprachlichen Entwicklung weiter, Jungen dafür – wiederum im Durchschnitt – etwas besser im räumlichen Vorstellungsvermögen und in ihren Spielen eher auf körperliches Kräftemessen aus“. Der Hormonexperte warnt jedoch davor, typische Neigungen von Buben allzu schnell den Testosteronschüben im Mutterleib sowie im ersten Lebensjahr zuzuschreiben. Während der gesamten Hauptphase der Kindheit liege der Testosteron-Spiegel bei Burschen nämlich nahezu bei null und komme erst ab der Pubertät wieder ins Spiel. Viele Verhaltensweisen haben also weniger mit den Hormonen der Kinder zu tun, als damit, wie Eltern, Freunde und Familie die Kleinen von Beginn an prägen. Und damit den gängigen gesellschaftlichen Vorstellungen darüber, was mit „männlich“ und „weiblich“ assoziiert wird.
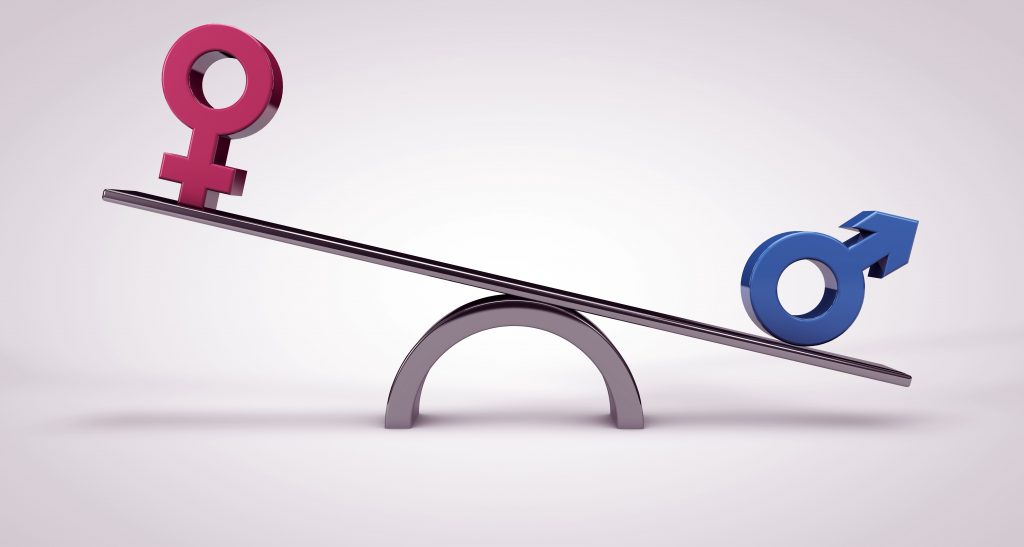
Anerzogene Geschlechterrollen
In ihrem Bestseller „Die Rosa-Hellblau-Falle – Für eine Kindheit ohne Rollenklischees“ beschreibt Almut Schnerring den essentiellen Einfluss der Sozialisation und erklärt, wie sehr Kinder – bewusst wie unbewusst – von klein auf geschlechterspezifisch erzogen werden. Die Autorin verweist auf Studien, die zum Beispiel zeigen, dass Eltern sogar mit Ungeborenen durch die Bauchdecke in unterschiedlicher Tonlage sprechen, und dass sie mehr mit ihm sprechen, wenn ihnen gesagt wurde, es sei ein Mädchen. Durch die Zuweisung in das jeweilige Rollenbild identifizieren sich Kinder innerhalb der ersten Lebensjahre nachweislich mit dem einen oder anderen Geschlecht und nehmen entsprechende Verhaltensweisen an. Diese orientieren sich wiederum am Rollensystem, das in der Familie vorgelebt wird, an gesellschaftlichen Werten und Normen und schließlich an den so genannten Peer Groups. Denn ab dem Kindergartenalter und erst recht in der Volksschule wird es für Kinder ganz wichtig, zu einer Gruppe dazu zu gehören, sich mit ihr zu identifizieren. Wissenschaftlichen Studien zufolge wollen Kinder ab einem bestimmten Alter nicht auffallen und nichts anders machen als die Kinder in ihrem Umfeld. Merkmale, Farbcodes, Symbole oder eben auch das stereotype Verhalten der jeweiligen Gruppe bestimmen die Kinder dabei gar nicht selbst. Sie reproduzieren vielmehr ein Bild, das von außen an sie herangetragen wurde. Marktanalysen bestätigen dies, indem Mädchen etwa angeben, Rosa über alles zu lieben und Buben sich als leidenschaftliche Aktionliebhaber outen. Aus Sicht der Forschung seien solche Interessenbekundungen ein klarer Verweis auf das Zugehörigkeitsgefühl eines Kindes zu einer Gruppe und weniger ein Beweis für genetische Veranlagungen.
Geldmache Gendermarketing
Wenngleich es in der Wissenschaft umstritten ist, wie viel an Geschlechterunterschieden tatsächlich angeboren und wie viel hingegen anerzogen ist, ist es hingegen augenscheinlich, dass sich die Konsumwelt daraus ihren Nutzen schlägt, in dem Kinder immer wieder in kulturell geprägte Bahnen mit entsprechenden Rollen gelenkt werden. „Es ist bedauerlich, dass ausgerechnet das verstärkt wird, von dem (vielleicht) sowieso schon mehr da ist, anstatt dass wir helfen, Defizite zu beheben“, kritisiert Almut Schnerring. „Mit Blick auf das höhere Unfallrisiko, die größere Gewaltbereitschaft, kürzere Lebenszeit und den Gender Care Gap, müssten da nicht alle kleinen Jungs jede Menge Puppen geschenkt bekommen und deren Empathie und Fürsorge intensiv gefördert werden?“, fragt sich die Buchautorin und Kommunikationsberaterin. Ginge es beim Spielzeugangebot um das, was Mädchen und Burschen wirklich wollen, und nicht um Umsatz, dann könnten die Produkte laut Schnerring schlicht mit „für Kinder“ beworben werden. Während dies bis Ende der 1990er noch überwiegend der Fall war, hat die Bedeutung von Genderklassifizierung und damit eine mitunter extrem separierte Warenwelt bis heute enorm zugenommen. Schließlich lässt sich mit typisierten Produkten und massenhaft geschlechterspezifischen Gadgets sehr viel mehr Geld verdienen. Dass alle Farben allen Kindern gehören, ein neutraler Look bei den Spiel- und Kleiderwelten oder gar die Wiederverwertung von Bubengewand für die jüngeren Mädchen und umgekehrt – das alles scheint in der gängigen Kinder-Konsumwelt nicht vorgesehen zu sein.

Rollenklischees hinterfragen und auflösen
Nicht umsonst fordern immer mehr Eltern, Erziehungsberichtigte und Pädagog:innen eine neutralere Symbolik bei Kinderprodukten, mehr Themenumkehr oder Werbung, bei der Mädchen und Buben etwa gemeinsam am Puppenherd oder in der Bauecke stehen. Gängigen gesellschaftlichen Vorstellungen darüber, was als „männlich“ oder „weiblich“ angesehen wird, könne man zum Beispiel mit neutralem Spielzeug ohne stereotype Botschaften und Verpackungen entgegensteuern. Mit Büchern und Filmen über weibliche Heldinnen, Jungs, die Schwäche zeigen, trans Kinder, queere Protagonist:innen, alternative Familienmodelle und vieles mehr. „In einer binären, klischeehaften Bilder-, Text- und Medienflut voll niedlicher, fürsorglicher Puppenmuttis und wilder, abenteuerlustiger Astronauten bleibt das Recht jedes Menschen auf freie Entfaltung der eigenen Persönlichkeit auf der Strecke“, ist Almut Schnerring überzeugt. Deshalb lohne es sich, bei der Wahl von Spielzeug, Filmen, Büchern, Liedern oder Games auf klischeefreie, diverse Darstellungen zu achten und Vorurteile über zum Beispiel Haarlängen, Kleidung oder Interessen immer wieder zu hinterfragen. „Für die Kinder sei es ein riesiger Gewinn, wenn sie dazu ermutigt werden, auch Vorlieben zu äußern, die eben nicht „typisch Mädchen“ oder „typisch Bub“ sind“, bestätigt Schnerring. Hirnforscher Gerald Hüther plädiert dafür, Menschen nicht länger in ihrer Verschiedenheit gegeneinander auszupielen: „Für eine gerechtere Welt abseits der kulturellen Funktion der Geschlechter sollten Menschen unterschiedlich sein dürfen ohne dass ihre Unterschiedlichkeit ständig von außen vereinnahmt oder bewertet wird“. Zumal die Anlagen bei allen gleich sind, sollte jedes Kind, seine Potentiale und Begabungen entfalten können. Um egal in welcher Farb- oder Fachwelt letztendlich seine Freude zu finden.


Forum
Diskutieren Sie über diesen Artikel
Insgesamt 0 Beiträge